Hauptstraße 59, 69117 Heidelberg
[javascript protected email address]
Unter „Selbstführung“ werden heute bei näherer Hinsicht zwei verschiedene Dinge verstanden. Zum Einen so etwas wie „Selbstoptimierung“, d. h. quantitative Leistungssteigerung, deren Ziele undiskutiert dem neoliberalen Denkmuster entnommen werden. Davon zu unterscheiden ist eine Art von Selbstführung, bei der der Einzelne auch die Zielrichtung seines Handelns bewusst bestimmt (Selbstorientierung). Der unterschiedliche Charakter dieser beiden Arten der Selbstführung wird erläutert als Konsequenz einer Weichenstellung des europäischen Denkens im 5. Jahrhundert v. Chr. zwischen der sokratischen und der sophistischen Denkrichtung. Vor diesem Hintergrund werden die beiden heute geltenden Auffassungen von „Selbstführung“ differenziert und erörtert. Die Mehrzahl der Führungslehren scheint dem sophistischen Muster zu folgen; als Beispiel für das sokratische Denkmuster wird die Dialogische Führung/Dialogische Kultur vorgestellt, wie sie am Hardenberg Institut seit ca. 30 Jahren entwickelt wird.
Im Bereich der Unternehmensführung steht seit einiger Zeit „Selbstführung“ hoch im Kurs. Doch impliziert der Wortgebrauch zwei ganz unterschiedliche Haltungen, die zu differenzieren ich hiermit vorschlage. Sie erinnern nach meinem Dafürhalten an eine Wegscheide des europäischen Denkens, die im 5. Jahrhundert v. Chr. in Athen erstmals artikuliert wurde, sich bis heute in der Geistesgeschichte durchgehalten hat und die von lebenspraktischer Bedeutung ist: die Unterscheidung zwischen einer sokratischen und einer sophistischen Art des Denkens. Zuerst werde ich auf diese beiden Denkarten eingehen, um danach die gegenwärtigen Auffassungen von „Selbstführung“ damit zu erläutern.
Am Anfang des 5. Jahrhunderts befand sich die Stadt Athen in einer paradoxen Situation: sie war befreit und total zerstört zugleich. Die Großmacht der Perser im Vorderen Orient galt als unbesiegbar und war wegen ihrer Brutalität gegenüber den Unterlegenen gefürchtet. Ihr Rachefeldzug gegen Athen hat jedoch sein Ziel wider Erwarten nicht erreicht. In der Seeschlacht bei Salamis im Jahre 480 v. Chr. konnte die erst kurz zuvor gebaute Flotte der Athener den persischen Angriff dauerhaft zurückschlagen. Die Einwohner der zerstörten Stadt hatten dank rechtzeitiger Evakuierung in der Mehrzahl überlebt (Näheres s. Dietz, 2019, S. 59-64). Dem danach einsetzenden Wiederaufbau verdankt Athen seine bis heute berühmten Bauwerke auf der Akropolis. Auch die inneren Strukturen der Stadt mussten wieder aufgebaut werden, jedoch unter einem neuen Vorzeichen: Durch ihren enormen persönlichen Einsatz als Ruderer der Kriegsflotte hatten so viele freie Bürger zum Sieg beigetragen, dass die Demokratie Zuspruch bekam und ab 461 v. Chr. in die Verfassung der Stadt einging. Da musste nun ziemlich rasch alles neu gegriffen werden, die Gesetze ebenso wie die politischen Ämter und das Gerichtswesen. Daneben nahmen Kultur und Künste einen enormen Aufschwung, und im Hinblick auf die Entwicklung des Denkens – damals sprach man noch nicht von „Philosophie“ – entstand eine Art Aufklärungsbewegung in zweifach ausgeprägter Form, verkörpert durch Sokrates einerseits und andererseits durch seine Gegenspieler, die Sophisten.
Zunächst zu Sokrates: Sohn eines Bildhauers, vermutlich von Haus aus nicht arm, bekannt für seine bedürfnislose Lebensweise. Er hielt sich vorzugsweise auf der Agora (Marktplatz) oder dem Gymnasion (Sportstätte) auf und verwickelte Mitbürger in Gespräche. Den Charakter dieser Gespräche kennen wir aus den Nachdichtungen seines Schülers Platon. Auf die für uns Heutige bestehende Schwierigkeit, zu beurteilen, welche Gedanken die des historischen Sokrates sind und welche eine spätere platonische Ausgestaltung, bin ich in meiner Sokrates-Schrift eingegangen (Dietz, 2019). Im Folgenden geht es ausschließlich um den historischen Sokrates. Dieser unterschied streng zwischen begründbarem „Wissen“ (episteme) und ungesicherter „Meinung“ (doxa). Er selbst beanspruchte keinerlei „Wissen“, sondern betonte stets: „Ich weiß, dass ich nicht weiß“ [nicht: „nichts weiß“! – KMD]. Er vertrat konsequenterweise nie irgendwelche inhaltlichen Ansichten oder Lehren. Sokrates unterschied sich darin von seinen Mitbürgern, die ihre Ansichten für „Wissen“ hielten – wie das auch heute noch üblich ist. Sokrates wies seinem Gesprächspartner regelmäßig nach, dass dieser das, was er zu wissen glaubte, in Wirklichkeit nicht wisse (sondern nur „meine“). Deshalb endete praktisch jedes Gespräch mit Sokrates ohne Ergebnis, in einer „Aporie“ (Weglosigkeit). Manche, denen Selbsterkenntnis am Herzen lag, schätzten das Gespräch mit ihm. So äußert sich einmal ein Gesprächspartner über Sokrates: „… es macht mir Spaß […], in seiner Gesellschaft zu sein, und ich glaube, es kann nichts schaden, wenn uns jemand auf die Fehler aufmerksam macht, die wir begangen haben oder jetzt noch begehen, sondern finde, man werde für sein späteres Leben unbedingt klüger, wenn man sich dem nicht entzieht […]. Mir ist es also nichts Ungewohntes und auch nichts Unangenehmes, mich von Sokrates durchforschen zu lassen“ (Platon, Laches 187e-188c). Zum größeren Teil fühlten sich die Gesprächspartner jedoch von Sokrates bloßgestellt, ärgerten sich über ihn (statt über ihr eigenes Nicht-Wissen) und wurden zu latenten Gegnern.
Zu seinem insistierenden Nachfragen fühlte sich Sokrates „beauftragt“ durch einen Orakelspruch in Delphi. Die inzwischen verschollene Inschrift am Tempel von Delphi: „Erkenne dich selbst“, wurde zu seinem Wahlspruch. Seine Art des Fragens lief auf Selbsterkenntnis hinaus. Im Gespräch mit anderen wollte er nicht wissen, was der Andere weiß, sondern, ob er das, was er zu wissen vorgibt, im Sinne von episteme (s. o.) auch wirklich weiß.
Das Lebensmotiv des Sokrates ist nach seiner eigenen Darstellung die „Sorge für sich selbst“ (epimeleia heautu) im Sinne einer „Sorge für die Seele“ (epimeleia tes psyches). Damit ist nicht Rückzug aus der Welt gemeint, sondern eine Wendung nach „innen“, ein Innehalten, und infolgedessen ein neues Verhältnis gegenüber dem äußeren Leben. Er habe, so sagt er in seiner Verteidigungsrede, die Mitbürger etwa so angesprochen:
Mein Bester, du bist doch ein Athener, ein Bürger der größten und an Bildung und Macht berühmtesten Stadt. Schämst du dich nicht, daß du dich zwar darum bemühst, wie du zu möglichst viel Geld, zu Ruhm und Ehre kommst, um die Einsicht aber und um die Wahrheit und darum, daß deine Seele möglichst gut werde, dich weder sorgst noch kümmerst?
Platon, Apologie 29c

Die Gespräche mit Sokrates betreffen den Menschen in seiner höchsten Form, der arete (wörtlich „Bestheit“) und deren Erscheinungsweisen (Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit). Früher war arete die Tugend der Oberschicht gewesen. Jetzt aber, in den demokratischen Zeiten Athens, ist sie nicht an noble Herkunft und traditionelles Verständnis gebunden. Jeder kann sie beanspruchen, muss aber, so Sokrates, gegenüber sich selbst darüber Rechenschaft ablegen, was er damit meint. Diese Bemühung steht im Mittelpunkt der von Sokrates geführten Dialoge. Er besteht gegenüber seinen Gesprächspartnern darauf, zuerst einmal zu klären, was arete (bzw. Tapferkeit, Besonnenheit usw.) überhaupt ist.
Komplett anders als Sokrates stehen zu diesem Thema die zeitgenössischen „Sophisten“, wandernde Klugheitslehrer aus verschiedenen Gegenden Griechenlands, mit denen sich Sokrates auseinandersetzt, wenn sie in Athen vorbeikommen. Ihr Maßstab ist der „Erfolg im Leben“: Gut ist, wer sich durchsetzt. Sie treten auf als „lebenskluge Allgemeinberater“ (Buchheim, 1986, S. 16) und versprechen, jeden, der bei ihnen Unterricht nimmt, dafür fit zu machen. Einige von ihnen stellen auch gerne den ungeheuren Umfang ihres Wissens oder spezielle Fähigkeiten zur Schau und lassen sich von den Zeitgenossen bewundern. Nach gesicherter Erkenntnis zu suchen, lehnen sie ab, erklären diese für unnötig oder für prinzipiell unerreichbar. Um im Leben Erfolg zu haben, braucht man sie jedenfalls nicht. Hier liegt der Dissens mit Sokrates.
Dass die Sophisten in Athen große Aufmerksamkeit finden, hängt zusammen mit ihrer lebenspraktischen Ausrichtung. Um erfolgreich zu sein, kommt es nicht darauf an, die Wahrheit zu erforschen, sondern es geht darum, die Einstellung der Mitmenschen zu beeinflussen. Dazu dienen beispielsweise der damals einsetzende neue Umgang mit der Sprache (Anfänge der Grammatik), mit dem Denken (Anfänge der Logik) und die Begründung eines bis heute wirksamen Instruments von Denken und Sprechen: der Rhetorik. Sie wurde zu einem entscheidenden Mittel, um in der damals neu eingeführten Demokratie Einfluss zu gewinnen, im Parlament ebenso wie vor Gericht.
Ob ich nun wie Sokrates die „Sorge für die Seele“, d. h. die Absicht, ein möglichst authentischer Mensch zu werden, zum Ziel meines Lebens mache, oder ob ich nach der Art der Sophisten gesellschaftlichen Erfolg im Leben anstrebe – macht einen deutlichen Unterschied. Aber viele Menschen in Athen haben das nicht durchschaut und Sokrates auch für einen Sophisten gehalten. So wurde er in einer schon damals weit bekannten Komödie von Aristophanes, „Die Wolken“, aufgeführt im Jahr 426 v. Chr., als eine Art Ober-Sophist lächerlich gemacht.
Worauf wollte Sokrates mit seiner „Sorge für die Seele“ hinaus? – Ausgangsbasis seines Denkens ist kritische Selbsterkenntnis. Und da Denken und Handeln für ihn unlösbar miteinander verbunden sind, bedeutet Selbsterkenntnis – so würde man heute sagen – zugleich Selbstführung. Und umgekehrt: kein Handeln ohne Selbsterkenntnis! Schlechtes Handeln beruht für Sokrates letztlich auf einem Denkfehler. Welcher Art aber ist dieses Denken? Wie schon gesagt, enden seine Dialoge de facto alle in einer „Aporie“, und dementsprechend gibt es von Sokrates keine allgemeine Lehre oder ethische Regel. Ein Denker aber, der auf allgemeingültige Erkenntnisse keinen Wert legt, scheint manchem auch heute noch schwer begreiflich. Wohl deshalb wird immer wieder versucht, z. B. in der „Verteidigungsrede“ des Sokrates Lehren oder Grundsätze zu finden (s. Dietz, 2019).
Wenn sokratisches Philosophieren also kein ergebnisartiges „Wissen“ hervorbringt – was ist dann an ihm bedeutend?
Sokrates fordert begrifflich klare Definitionen und ein geregeltes Beweisverfahren, aufgrund dessen man nicht nur weiß, dass etwas so oder so ist, sondern auch, warum es so ist. Auch fordert Sokrates unnachgiebig Rechenschaft von jedem, der ein „Wissen“ beansprucht – was er selbst ja nicht tat (s. o.). Heute würde man unterscheiden zwischen Gedankeninhalt und Denkmethode (Logik). Wozu aber braucht man eine exakte Methode, wenn es doch gar nicht um Wissen geht? Die bis heute selbstverständliche logische Grundlage wissenschaftlichen Denkens war damals ein Novum, das von Sokrates in die Geistesgeschichte eingebracht wurde, wie Aristoteles bezeugt (Aristoteles, Metaphysik 1078b 27-32). Das von Sokrates geforderte exakte Denken hat offensichtlich einen anderen Sinn als den, Kenntnisse zu erwerben. Es steht im Dienste der Selbstprüfung, nicht der Gelehrsamkeit. Sokrates ruft sich und seine Mitmenschen dazu auf, keine ungeprüften Vorstellungen in das Bewusstsein einzulassen, und unterzieht alles, was man als vermeintliches Wissen darin vorfindet, einer eingehenden Prüfung (elenchos). Die Besinnung des Einzelnen auf sich selbst setzt mit Selbstreflexion ein, erfordert Selbstkritik und mündet in selbst-geführtes Handeln ein. Mit einer später von Aristoteles getroffenen Unterscheidung ausgedrückt, geht es hier nicht um ein inhaltsbezogenes „Lernen“ (mathein), sondern um ein „Erfahren“ (pathein), d. h. „sich in einen Zustand versetzen lassen“ (diatethenai) (Aristoteles, fr. 15; s. Düring, 1966, S. 543; Dietz, 2019, S. 96). In diesem Sinne ging es Sokrates nicht um Wissen, sondern um eine innere Haltung, beruhend auf der Selbstkontrolle des Denkens.
Das entnehmen wir auch einigen Fragmenten der sogenannten „Sokratiker“, eigenständige Philosophen in der Nachfolge des Sokrates, von denen leider nur wenig erhalten ist. Nach deren übereinstimmendem Zeugnis war es Ziel der von Sokrates geführten Gespräche, „die eigenen Fehler zu erkennen und sich von ihnen zu befreien“ (Aristipp, fr. 49 nach Döring, 1984, S. 26). – Für die Bedeutung des Denkens in der weiteren abendländischen Kultur steht Sokrates an einer Wegscheide. Der Gräzist Albrecht Dihle macht dazu eine interessante Beobachtung: Während Platon, dessen Schüler Aristoteles und ihre Nachfolger das von Sokrates eingeführte kritische Denken zur Grundlage von Wissenschaft machen, ist bei seinen anderen Nachfolgern, den Sokratikern, eine Abneigung gegen intellektuelle Tätigkeit und Gelehrtheit herauszuhören, womit sie sich deutlich von der platonischen Richtung abheben (Dihle, 2001, S. 217). – Die Sorge für die Seele, das Lebensmotiv des Sokrates, beginnt ganz offensichtlich mit einer Art „Reinigung“ des Denkens von ungeprüften Vorstellungen, Vorlieben, Abneigungen und Vorurteilen. Der von Sokrates in die Geistesgeschichte eingeführte „Dialog“ dient der Pflege dieser inneren Haltung, durch die der Einzelne „besser werden“, d. h. über seinen vorfindlichen Entwicklungszustand hinausgelangen kann.
Die Kontroverse zwischen Sokrates und den Sophisten besteht u. a. darin, dass sich die Sophisten mit Erfahrungswissen (doxa) zufrieden geben und mit Hilfe schein-logischer und rhetorischer Verfahrensweisen „besser“, d. h. „erfolgreicher“ werden wollen als ihre Mitmenschen; dass dagegen Sokrates das „Möglichst-gut-Werden“ (arete, „Bestheit“) darin sieht, ausgehend von einem exakten Denken sein Handeln an dieser Art von „Bestheit“ auszurichten (Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit). Bei den Sophisten heiligt sozusagen der Zweck die Mittel. Bei Sokrates werden umgekehrt die Mittel, die er anwendet, „heilig“ gehalten in dem Sinne, dass sie sich nicht zu irgendeinem Nebenzweck missbrauchen lassen, sondern unmittelbar der „Wahrheit“ (aletheia) dienen. – Im griechischen Wahrheitsverständnis ist die objektive Seite („Wirklichkeit“) noch ungeschieden von der subjektiven („Wahrhaftigkeit“, „Aufrichtigkeit“).
Wie sich inzwischen zeigt, beginnt mit dieser Kontroverse im 5. Jahrhundert v. Chr. eine Weichenstellung für die weitere Geistesgeschichte. Die eine der beiden Strömungen des Denkens geht auf den persönlichen Nutzen, die andere auf Wahrheit und Wirklichkeit. Beide Strömungen sind seither nie ganz verschwunden, haben jedoch im Laufe der Geschichte immer wieder andere Formen angenommen (vgl. Dietz, 2019, S. 102-104). Die beiden Positionen sind, so scheint mir, im heutigen Diskurs der „Selbstführung“ wiederzuentdecken, und zwar mit frappierender Ähnlichkeit zu damals.
Was heute als „Selbstführung“ beschrieben wird, gleicht oftmals einer Selbstanpassung an die jeweils herrschenden Erwartungen: einer „Selbstoptimierung“, die gemessen und quantifiziert werden kann. Das Prinzip der Messbarkeit beherrscht ohnehin den verbreiteten Diskurs über die „Kompetenzen“ (vgl. Erpenbeck et al., 2017); es gilt weit über die Arbeitswelt hinaus: „Eine allgemeine Hinwendung einzelner Individuen zu quantitativer Bewertungslogik lässt sich ganz aktuell im Trend der Selbstvermessung, der Quantified-Self-Bewegung, beobachten. […]“, auch hinsichtlich nicht-körperlicher Aktivitäten wie z. B. Motivation, Arbeitsabläufe, soziale Interaktion oder Freizeitbeschäftigung (Deutsch 2020, S. 63). Der Soziologe Hartmut Rosa äußert gegen diese Quantifizierung schwere Bedenken: „Wahlometer geben uns auf die Kommastelle genau an, welches politische Programm bei uns Resonanz auslöst, die Armbänder der Quantified-self-Bewegung informieren uns minutiös, ob wir mit unserem Körper in Resonanz sind, die Beziehungsbarometer der psychologischen Tests verraten uns, ob es in unserem Privatleben und mit der Liebe klappt und wie es um unser seelisches Gleichgewicht bestellt ist […] Was auf diese Weise jedoch auf der Strecke bleibt, ist die Berührung durch das unverfügbare Andere (i. O. kursiv), mit dem wir in eine Antwortbeziehung treten, die Widerspruch erlaubt und fordert und eine transformative Anverwandlung ermöglicht, welche ihrerseits wiederum die tätige Erfahrung von Selbstwirksamkeit voraussetzt. Wo sich Resonanz in diesem umfassenden Sinn nicht mehr einstellt, weil sich die Wechselwirkung zwischen Subjekt und Welt in einem Anstoß zur Rührung oder in einer durch warenförmige Stimulation erzeugten Echowirkung erschöpft, findet keine wirkliche Begegnung mehr statt“ (Rosa, 2019, S. 620f.). Mit anderen Worten: ubiquitäre Quantifizierung untergräbt die Fundamente des Menschseins.
Der Soziologe Stefan Selke beschreibt „wie die digitale Selbstvermessung unsere Gesellschaft verändert“ (Selke, 2016): „Die beste Methode, die Welt zu beherrschen, besteht darin, sie zu vereinheitlichen.“ Dies bleibt weitgehend unbemerkt: „Obwohl wir uns alle für Individualisten halten, ist die Standardisierung so weit fortgeschritten wie nie.“ (Selke, 2016, S. 241). Selbstvermessung ist daher „kein geeigneter Weg, um das spezifisch Menschliche an uns kennenzulernen.“ (Selke, 2016, S. 245).
Verzweckung des Menschen, Verlust des spezifisch Menschlichen durch „Selbstverdinglichung“, Entfremdung von der Lebenswelt, Sinnleere, fehlende Selbstreflexion, Verwechslung von Zwang und Freiheit – all diese Begleiterscheinungen von Selbstoptimierung kennen wir aus der Arbeitswelt.
„Lebenslanges Lernen“ wird gegenüber seinen Anfängen in der Bildungsreform der 1960er Jahre heute in einer neuen, spezifischen Bedeutung gebraucht. Der kürzlich verstorbene Richter am Bundesverfassungsgericht, Ernst-Wolfgang Böckenförde, findet „lebenslanges Lernen“ auf die Erfordernisse der Wirtschaft ausgerichtet „Der Wert und die Verwendbarkeit der Menschen ist an ihre Nützlichkeit, ihren Beitrag zu Produktivität, Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit gebunden; als Humankapital müssen sie billig, flexibel, ständig auf der Höhe der Zeit und rezyklierbar sein, als Person kommen sie nicht ins Blickfeld.“. Die Menschen „erfahren sich in ihren Kenntnissen und Fertigkeiten als Produktionsware, die sich am Arbeitsmarkt optimal verkäuflich machen muss. Dem Einzelnen wird Flexibilität, Lebenslanges Lernen, freiwillige Selbstoptimierung, letztlich die totale Mobilisierung zur Erhaltung und Steigerung seiner Produktion nach den Anforderungen des Wirtschaftsprozesses nahegelegt (Böckenförde, 2011, S. 43; vgl. North, Reinhardt & Sieber-Suter, 2018, S. 328f.).
„Selbstführung“, so verstanden, gleicht einer Selbstunterwerfung unter neoliberale Grundsätze, einer als „Freiheit“ deklarierten Selbstanpassung!
Die stillschweigende Orientierung des Führungsverständnisses am homo oeconomicus ordnet den einzelnen Menschen von vornherein bestimmten „Zwecken“ unter, die nicht in Frage gestellt werden. Der homo oeconomicus, seinem Wesen nach selbstbezogen und nutzenorientiert, rational und damit berechenbar, engagiert sich für das Ganze, weil er sich davon etwas für sich verspricht. Was da oft als „Entwicklung“ bezeichnet wird, gleicht eher einem „Rattenrennen“ (rat-racing, so von Felden, 2020, S. 3, 5).
Als wie selbstverständlich heute die hier problematisierte Ausrichtung von „Selbstführung“ vielerorts genommen wird, zeigt eine knappe Einführung in „Essentials in Self-Leadership“ (Furtner, 2017). Hier nur einige Formulierungen: „Herzstück“ von Self-Leadership seien die „natürlichen Belohnungsstrategien, welche einen positiven Einfluss auf die Königsklasse der menschlichen Motivation, die intrinsische Motivation, ausübt“. „Mittels Self-Leadership können Personen sowohl ihre persönliche Leistung steigern, ihre Ziele effektiver verwirklichen als auch im Führungs- und Teamkontext Spitzenleistungen erbringen.“ (Furtner, 2017, VII). Es gehe darum, „die eigenen Gedanken, Emotionen und das Verhalten zielorientiert zu beeinflussen und in eine positive Richtung zu lenken“, um so „Macht, Wissen und Kontrolle über sich selbst zu gewinnen“ (Furtner, 2017, S. 1).
Die Mehrzahl der heutigen „Selbstführungstheorien“ läuft tendenziell auf eine Optimierung des sophistischen Ansatzes hinaus: Diskussion statt Dialog, Wettbewerb statt Kooperation, Selbstoptimierung statt arete, definierte und „trainierbare“ Kompetenzen zur Erfüllung vorgegebener Zielsetzungen, subjekt-orientiertes Vorgehen, Nutzen statt „Wahrheit“ im oben gekennzeichneten Doppelsinn. Und im Verhältnis zu den Mitmenschen: Manipulation statt Aufrichtigkeit. Selbst wenn in manchen Unternehmen ausdrücklich erklärt wird: „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt“, schließt das Zweckrationalität nicht aus. Der Satz würde ja z. B. auch für Kannibalen gelten. – Hier kann sich nur jeder selbst zur Wachsamkeit aufrufen, um nicht in die „Optimierungsfalle“ (Bröckling) zu geraten.
Dem Verständnis von Selbstführung als „Selbstoptimierung“ kann unter der Bezeichnung „Selbstorientierung“ ein anderes Verständnis von Selbstführung gegenübergestellt werden, das sich zurückführen lässt auf die von Sokrates begründete Art des Denkens.
Im Sinne des Sokrates fehlt der Selbstoptimierung die Selbsterkenntnis als Ausgangspunkt. Anpassung an vorgegebene Zielsetzungen ohne selbstkritisches Innehalten wäre genau das Gegenteil dessen, wozu Sokrates seine Mitbürger ausdrücklich auffordert:
Wenn ich umhergehe, tue ich nichts anderes als Euch, Jung und Alt, zu überreden, nicht mehr so sehr für den Leib zu sorgen noch für das Geld, sondern mehr um die Seele und darum, dass sie möglichst gut werde. Dabei sage ich dann, dass nicht aus dem Reichtum Tugend kommt, sondern aus der Tugend Reichtum und alle anderen Güter, für die einzelnen Menschen wie für die Allgemeinheit.
Platon, Apologie 30a-b

(Bild: Büste des griechischen Philosophen Sokrates)
Da Sokrates es für selbstverständlich hält, dass menschliches Handeln dem Denken unmittelbar folgt, geht es bei seinem Lebensmotiv „Sorge für die Seele“ genau um dasjenige, was hier „Selbstführung“ als Selbstorientierung genannt wurde, nämlich um ein Wirken in der Welt, das über die Belange der eigenen Person hinaus die soziale (und heute auch die natürliche) Umwelt mit einbezieht. Dazu genügt kein subjektives Meinen, sondern ich muss über meine persönlichen Befindlichkeiten hinaussehen und andererseits „Rechenschaft ablegen“ können von dem, was ich behaupte. Im Dialog im Sinne von Sokrates geht es weniger um spezielle Sachverhalte als um die Suche nach innerem Einklang mit sich selbst.
Ausgehend vom Selbstführungscharakter des „sokratischen“ Dialogs entwickeln wir im Hardenberg Institut seit ca. 30 Jahren „Dialogische Führung“ bzw. „Dialogische Kultur“. In einer solchen Unternehmenskultur werden die praktischen Möglichkeiten ausgelotet, in Selbstführung im sokratischen Sinne zusammenzuarbeiten. Die Intention ist, den Einzelnen ein eigenständiges Handeln im Sinne des Ganzen zu ermöglichen – das Gegenteil von „freiwilliger Anpassung“, andererseits aber in keiner Weise mit „eigenwillig“ oder „eigensinnig“ zu verwechseln. Mit seinem eigenständigen Handeln stellt man sich in das „Ganze“ und gestaltet es dadurch zugleich mit. Die Fortentwicklung und Ausgestaltung des „Ganzen“ entsteht durch die Beiträge der Einzelnen im Zuge ihrer Selbstführung: bei jeder Einzelhandlung ist auch das Ganze im Blick. – Dialogische Kultur setzt daher auf grundlegend veränderte Einstellungen:
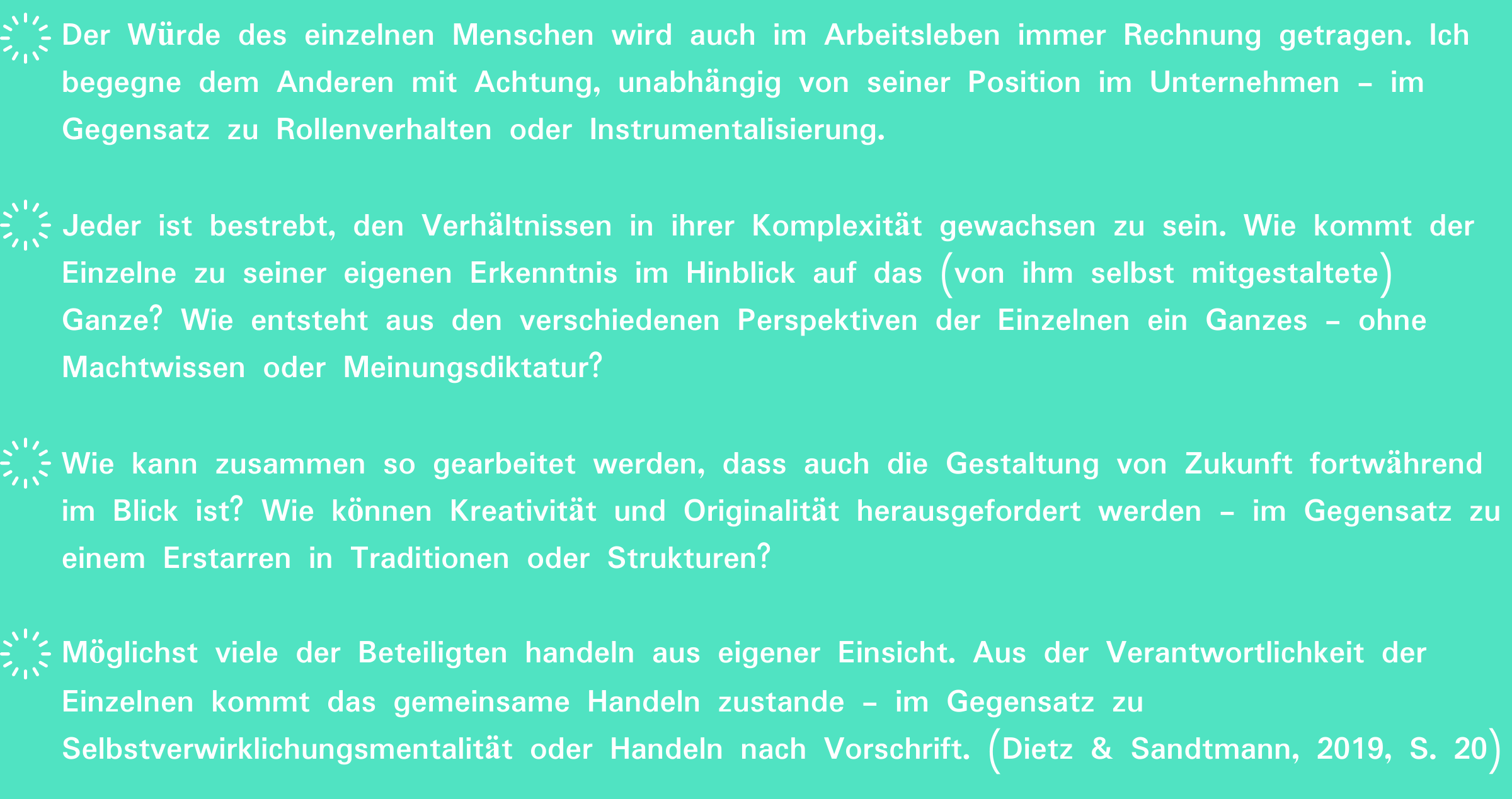
Dialogische Kultur ist kein Modell, das man entwerfen, irgendwo „implantieren“ und dann „evaluieren“ könnte. Vielmehr bildet sie sich nach und nach heraus durch konsequenten Vollzug ihrer Intention in der jeweiligen Arbeitsgemeinschaft. – Da entstehen natürlich sofort viele weitergehende Fragen. Worauf ist dabei zu achten? Was bedeutet da „Führung“? Wie steht es mit der Effizienz bei diesem Vorgehen? u.v.a.m. Im Kontext dieses Aufsatzes kann darauf nicht eingegangen werden, es gibt aber eine Reihe von Publikationen aus verschiedenen Blickwinkeln und Erfahrungen heraus. (https://dialogischefuehrung.de)
Aristoteles (1970). Aristotelis Fragmenta Selecta, hrsg. von Ross, W. D. Clarendon Press.
Aristoteles (1963). Aristotelis Metaphysica, hrsg. von Jaeger, W. Clarendon Press.
Böckenförde, E.-W. (2011). Wissenschaft, Politik, Verfassungsgericht / Aufsätze von Ernst-Wolfgang Böckenförde. Suhrkamp.
Bröckling, U. (2013). In der Optimierungsfalle. Zur Soziologie der Wettbewerbsgesellschaft. Supervision, 4.2013, 4-11.
Buchheim, T. (1986). Die Sophisten als Avantgarde normalen Lebens. Meiner.
Deutsch, K. (2020). Die Vormacht der Zahlensprache und die Vermessung des Selbst. In: H. v. Felden (Hrsg.), Selbstoptimierung und Ambivalenz (S. 49-68). Springer.
Dietz, K.-M. (2008). Jeder Mensch ein Unternehmer. KIT.
Dietz, K.-M. (2014). Dialog. Die Kunst der Zusammenarbeit. Menon.
Dietz, K.-M. & Kracht, T. (2016). Dialogische Führung. Grundlagen – Praxis – Fallbeispiel: dm-drogerie markt. Campus.
Dietz, K.-M. (2019). Sokrates: ich - hier – jetzt. Dialog-Perspektiven. Menon.
Dietz, K.-M. & Sandtmann, A. (2019). Eigenständig im Sinne des Ganzen: Zur Intention der Dialogischen Kultur. Menon.
Dihle, A. (2001). Das exemplum Socratis und die Wissenschaft. In H. Kessler (Hrsg.), Nachfolge und Eigenwege. Sokrates-Studien V (S. 115-134). Die Graue Edition.
Döring, K. (1984). Der Sokrates des Aischines von Sphettos und die Frage nach dem historischen Sokrates. Hermes, 112, H. 1, 16-30.
Düring, I. (1966). Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens. Winter.
Erpenbeck, J., Rosenstiel, L. v., Grote, S. & Sauter, W. (2017). Handbuch Kompetenzmessung: Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis.Schäffer-Poeschel.
Felden, H. v. (2020). Selbstoptimierung und Ambivalenz. Springer.
Furtner, M. (2017). Self-Leadership: Basics. Springer.
North, K., Reinhardt, K. & Sieber-Suter, B. (2018). Kompetenzmanagement in der Praxis. Mitarbeiterkompetenzen systematisch identifizieren, nutzen und entwickeln. Springer.
Platon (1974). Sämtliche Werke in 8 Bänden, übersetzt von Rudolf Rufener. Artemis.
Rosa, H. (2019). Resonanz – Eine Soziologie der Weltbeziehung. Suhrkamp.
Selke, S. (2016). Lifelogging: Wie die digitale Selbstvermessung unsere Gesellschaft verändert. Econ.